Im Interview spricht sie über ihre Forschung, ihre Leidenschaft für zeitgenössische Kunst und ihre Sicht auf die Werkstattwoche.
Carla Wiggering, in wenigen Monaten wird Weltklasse-Kunst das Künstlerdorf Lüben bereichern und das internationale Kunstfestival startet. 20 verschiedene Kunststile bringen eine beeindruckende Vielfalt an Nationen und Menschen zusammen. Welche Emotionen und Gedanken löst das in Ihnen als Kuratorin des Projektes aus?
Mit großer Vorfreude erwarte ich die diesjährige Werkstattwoche Lüben. Als Kuratorin begeistert mich das Konzept der Förderung von junger Kunst und der Möglichkeit des intensiven Austausches der Künstler*innen und Menschen in der Region. Das Festival bietet aus meiner Sicht eine wunderbare Gelegenheit, die stilistische und thematische Breite der zeitgenössischen Kunst kennenzulernen. Von Malerei und Skulptur bis zur Fotografie und digitalen Kunstformen werden von den teilnehmenden Künstler*innen vielfältige Ansätze vertreten. Ich bin gespannt, welche Werke während des einwöchigen Festivals entstehen werden! Ich freue mich auf die Möglichkeit, gemeinsam mit dem Team der Werkstattwoche, den Künstler*innen, den Dorfbewohner*innen und Besucher*innen einen Erfahrungsraum für Kunst und Kultur zu schaffen.
Was bedeutet „Contemporary Art“ für Sie persönlich, und welche Erfahrungen oder Eindrücke aus diesem Bereich können Sie in die Arbeit der Werkstattwoche einbringen?
Zeitgenössische Kunst zeichnet sich für mich durch eine beeindruckende Pluralität an künstlerischen Ausdrucksformen und Themen aus. Viele Künstler*innen beschränken sich dabei nicht nur auf ein einziges Medium, sondern nutzen eine Vielzahl unterschiedlicher Materialien und Techniken in ihren Arbeiten. Von Malerei, Grafik, Bildhauerei, Fotografie, Medienkunst über Licht, Sound, Performance und Installationen lassen die Künstler*innen die Grenzen zwischen den Medien verschwimmen, um ihre Ideen umzusetzen. Dabei sind sie auch zunehmend transdisziplinär ausgerichtet. Diese Vielseitigkeit fesselt mich seit meinem Studium der Kunstgeschichte, in dem ich mich intensiv mit verschiedenen Themen der modernen und zeitgenössischen Kunst auseinandersetzte. Mein Interesse an aktuellen Diskursen begleitet mich dabei in meinen verschiedenen Tätigkeiten. Bei diesen hatte ich die Möglichkeit, mit unterschiedlichen Künstler*innen zusammenzuarbeiten – eine Erfahrung, die ich gerne in die kuratorische Begleitung des Festivals einfließen lasse. Da die Kunstwerke erst vor Ort entstehen, ist ein enger Dialog mit den Künstler*innen besonders wichtig. Als Kuratorin freue ich mich auf diesen regen Austausch, der mir eine einzigartige Perspektive auf den kreativen Entstehungsprozess der Arbeiten ermöglicht.
Ihre preisgekrönte Masterarbeit konzentrierte sich auf Fotografie. Sehen Sie dieses Medium als ausschließliche Ausdrucksform zeitgenössischer Kunst?
Nein, natürlich nicht! Die zeitgenössische Kunst ist sehr vielfältig. Und gerade durch diese Vielfalt hat sie die Möglichkeit, die unterschiedlichen Interessen vieler Menschen zu wecken. Neben neuen Medien wie der Fotografie und Videokunst sprechen mich beispielsweise auch Malerei, Skulpturen, Installationen und Performance an. Inhaltliche Themen wie die Auseinandersetzung mit Umwelt, Archiven und Gemeinschaft wecken ebenso mein Interesse. Die Liste lässt sich weiter fortführen und wächst stetig…
Das internationale Kunstfestival Werkstattwoche steht für ein einzigartiges, friedliches Miteinander verschiedener Kulturen. Inwiefern beeinflusst oder bereichert diese interkulturelle Zusammenarbeit Ihre Arbeit? Welche Chancen oder Risiken sehen Sie für Ihre Arbeit vor Ort?
Die zeitgenössische Kunst und ihre Künstler*innen stehen für eine Vielfalt von Stimmen und Perspektiven, die aktuelle gesellschaftliche Diskurse aufgreifen und prägen. Ein zentrales Anliegen meiner kuratorischen Tätigkeit ist es, diese verschiedenen Diskurse in einem breiten Ausstellungs- und Vermittlungsprogramm abzubilden. Dabei stellt die Zusammenarbeit mit regionalen und internationalen Künstler*innen für mich eine absolute Bereicherung dar. Sie ermöglicht mir, mein eigenes Wissen und meine persönliche Perspektive zu erweitern. Diesen Dialog durch die Vernetzung und Begegnung verschiedener Menschen erachte ich als einen wichtigen Beitrag zu einer offenen und vielfältigen Gesellschaft. In einer Zeit, in der eine Tendenz zur Abschottung und Ausgrenzung erstarkt, sind kulturelle Projekte wie die Werkstattwoche Lüben ein Zeichen und eine Plattform für diese gesellschaftliche Offenheit. Ich sehe in der Zusammenarbeit vor Ort eine große Chance, im gemeinsamen Austausch und der Teilhabe vieler gesellschaftliche Vielfalt zu leben.
Das Konzept steht für die Förderung junger Kunst, eine Plattform für den weiteren Schritt in der Karriere. Wie sehen Sie persönlich diesen Ausblick und was schätzen Sie besonders an dem Konzept Werkstattwoche?
Es ist ungemein wichtig, dass Künstler*innen am Anfang ihrer Karriere eine Plattform zur Weiterentwicklung und Präsentation ihrer Kunst erhalten. Dabei leisten kulturelle Institutionen wie die Werkstattwoche Lüben mit ihren Förderprogrammen einen zentralen Beitrag. An dem Konzept der Werkstattwoche fasziniert besonders die Verbindung von Kunstförderung und kultureller Bildung. Die Künstler*innen schaffen vor Ort nicht nur Kunst, sondern sind für eine kurze Zeit Teil der Gemeinschaft und erleben und leben diese. Dadurch ist ein kreativer Austausch zwischen den teilnehmenden Künstler*innen und den Menschen aus der Region möglich. Mich begeistert die breite Vermittlung der künstlerischen Positionen durch Artist Talks, Führungen und Workshops – ein vielseitiges Programm! Die Werkstattwoche Lüben zeigt damit die Fähigkeit der Kunst auf, die Begeisterung und das Interesse vieler Menschen zu entfachen.
Ohne unser Kunstdorf und seine engagierten Bewohner wäre das Projekt nicht möglich. Wie gelingt es Ihnen, Kunst einem Publikum näherzubringen, das sonst wenig Berührungspunkte hat?
Ganz entscheidend ist der Dialog mit dem Publikum: Was interessiert die Besucher*innen, die regelmäßig Kunst betrachten, und was interessiert Menschen, die noch nicht so viele Berührungspunkte mit diesem Feld haben? Welche Barrieren gibt es und wie können sie abgebaut werden? Essenziell ist – neben der Wahl des Ausstellungsthemas – die Vermittlung im Ausstellungsraum und das begleitende Angebot, das auf verschiedene Interessen und Gruppen eingeht. Viele Museen und Kunstinstitutionen haben in diesem Bereich bereits spannende Konzepte für ihre Ausstellungen entwickelt, die sie stetig weiterführen. Seien es klassische Führungen für alle Altersklassen, wissenschaftliche Vorträge und Artist Talks, Konzerte oder Filmvorführungen, Yoga in der Ausstellung, Spielräume für Kinder und Erwachsene sowie Projekte, die gezielt den Stadt- und Dorfraum einbeziehen, lassen sich verschiedene Ansätze finden! Um Barrieren im Kulturbereich abzubauen, halte ich zudem die Vernetzung und Kooperation mit anderen Kultureinrichtungen, Vereinen und Initiativen für wichtig, um in einen Austausch zu treten. Als junge Kuratorin wünsche ich mir inklusive Räume zu gestalten, in denen eine breite Gesellschaft zusammenkommt.
Carla Wiggering betrachtet Kunst aus neuen Perspektiven – mit einem besonderen Fokus auf Contemporary Art. Während ihres Studiums der Kunstgeschichte an der Universität Heidelberg und der Goethe-Universität Frankfurt am Main hat sie sich mit verschiedenen künstlerischen, theoretischen und ästhetischen Fragestellungen in Bezug auf Fotografie und Film sowie künstlerischen Positionen auseinandergesetzt, die gegenwärtige, gesellschaftliche Diskurse thematisieren.
2022 wurde ihre Masterarbeit „‚Il y a mieux à faire dans la vie que copier‘ – Man Rays Aufnahmen der Totenmasken von Amedeo Modigliani und Sergei Diaghilev im Kontext von Fotografie und Fototheorie der 1920er Jahre“ mit dem renommierten Cellini-Master-Preis der Benvenuto-Cellini-Gesellschaft e.V. ausgezeichnet. In dieser untersuchte sie unter anderem, wie der Künstler Man Ray mit experimentellen Techniken die künstlerischen Möglichkeiten der Fotografie auslotete.
Am Kunstmuseum Wolfsburg war Carla Wiggering als wissenschaftliche Volontärin Teil des kuratorischen Teams und setzte sich mit aktuellen Fragen der Museumsarbeit auseinander. Dabei wirkte sie als kuratorische Assistenz an zahlreichen Ausstellungen mit:

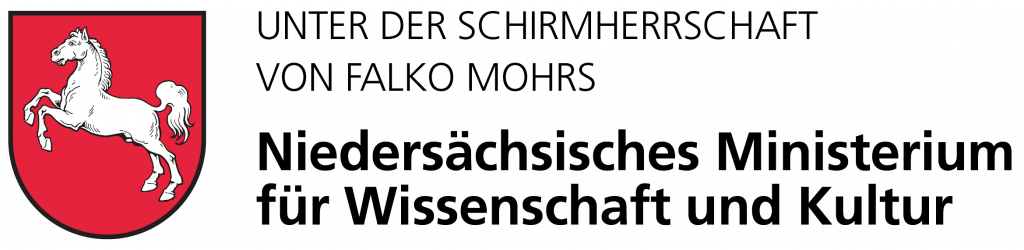


© 1991–2025 WERKSTATTWOCHE